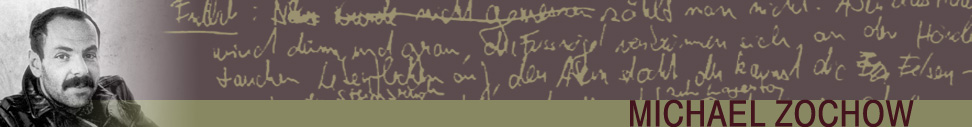 |
 |
Peter meiers Erstling "Stationen" |  |
|
Schaffhauser Nachrichten
Die Sätze, bei welchen ich weinte, stehen im Konjunktiv der indirekten Rede: distanzierter, diskreter geht es fast nicht mehr. Was ich las, ist dann auch weder pathetisch noch sentimental geschrieben, es ist sachlich, in Gefühlen zurückhaltend. Ein leises, streng privates, bescheidenes Unglück, ein Unglück etwa wie ein Schrebergarten wird da zart skizziert, vorsichtig, damit es niemanden trifft. Und deshalb trifft es. Die Rede ist von Peter Meiers Erstlingswerk «Stationen, Erinnerungen an Jakob Meier, Zugführer SBB», erschienen im Zytglogge-Verlag, Bern. Der Sachverhalt: der Sohn, zurzeit der Kulturredaktor am «Tages-Anzeiger», erinnert sich an seinen 1975 verstorbenen Vater, einen Arbeiter. Komplexe Betrachtungsweise Tag- und Nachtschichten, unterdurchschnittlicher Lohn, Flucht vor dem Alltag ins Jassspiel, das seiner Regelmässigkeit wegen zum Alltag wird, Unfähigkeit, seine Gedanken und vor allem seine Gefühle zu artik uli eren, mehrjährige Mitgliedschaft in der PdA, später Sympathien für Schwarzenbach - da haben wir es, das Klischee vom Schweizer Arbeiter. Was fehlt, ist die tägliche Sauferei, aber Herr Jakob Meier trank eben nicht. Andererseits: der Sohn geniesst eine gute Schulbildung, studiert in der Uni, macht den Doktor, beginnt bei der Zeitung zu arbeiten, wird als Korrespondent ins Ausland geschickt, wird Redaktor. Auch ein Klischee: vom Arbeiterkind zum Journalistenstar. Schön sind die zwei Klischees, sie sind repräsentativ, sie sind exemplarisch. Nun, das gemeinsame Merkmal aller Klischees ist die Leere, ist das Fehlen des Inhalts, den zu vertreten sie vortäuschen. Ein Klischee ist immer nichtssagend. Das Bemerkens- und Bewundernswerte an den «Stationen»: Peter Meier nimmt die Klischees auseinander und entdeckt darin aufgrund seiner Erlebnisse und Reflexionen den dazugehörenden Inhalt. Die Beschreibung des «typischen» Arbeiters hängt dann nicht mehr im luftleeren Raum der Ideologie, sie hat ihren festen Halt in der persönlichen Erfahrung. So wütet zum Beispiel Meier nicht gegen die unregelmässige Arbeitszeit des Vaters, einige Male wird aber das abendliche Warten der Familie auf den Vater evoxiert. Und das sind bedrückende Szenen. Der Begriff, die gleichgültige Bezeichnung «unregelmässige Arbeitszeit» wird in Meiers Wiedergabe vom Leser erlebt, erfühlt, erfasst. Solche Details haben neben ihrer bildhaften, konkretisierenden Funktion noch eine andere Wirkung: sie formen im Leser ein soziales Bewusstsein, das in seiner Folgerichtigkeit unangreifbar ist. Denn es wird ausschliesslich durch persönliche Erfahrungen geprägt, hat also eine Grundlage, die ich als existenziell bezeichnen würde. Die Grunderfahrung: der Tod Warum dann so viel Platz den immerhin recht detaillierten Beschreibungen der Sterbe Vorgänge einräumen? Macht vielleicht das Sterben das Leben aus? In einem gewissen Sinn ja. Der Tod ist für Meier die Projektionsebene, auf welcher er das Leben des Vaters betrachtet. Während der Lektüre habe ich mich oft gefragt, warum für mich (und offensichtlich auch für den Autor) die unscheinbarsten, ja banalen Episoden, die sachlich, korrekt, manchmal fast betont unspektakulär berichtet werden, auf einmal, völlig unsachgemäß, so viel Bedeutung gewinnen. Warum sie mich rühren, warum sie mich mitfühlen lassen. Erst nach der Lektüre ist mir klargeworden, dass auf einem solchen Hintergrund keine Episode banal, keine Sprache nüchtern genug sein kann. Der Tod und seine Qualen schimmern durch. Und doch wurde ich den Eindruck nicht los, dass es gerade der Tod ist, der die familiären Beziehungen belebt, der die schamhaft verschlossenen Herzen gewaltsam öffnet. Zu den ergreifendsten Szenen im Buch gehört sicher der verzweifelte Gefühlsausbruch des Vaters am Sarg der Mutter. Als hätte tatsächlich erst ihr Tod den Vater dazu veranlasst, seine Liebe für sie zu zeigen. Dass der äussere Anlass, warum Peter Meier das Buch über seinen Vater schrieb, ebenfalls der Tod ist, ist nicht weniger traurig. Man hat halt seine Gefühle versteckt zu halten. Beklemmende Atmosphäre Vor kurzem las ich das Buch «Mars» von Fritz Zorn. Auch ein autobiographisch sozial kritisches Buch, das sich eingehend mit Krebs beschäftigt. Es liegt mir nun fern, zwei Bücher nur annähernd ähnlicher Thematik und grundverschiedenen Charakters gegeneinander auszuspielen. Ich begnüge mich mit der Feststellung, dass ich bei «Mars» kein Tränchen habe vergiessen müssen. Sein grossbürgerliches Elend hat mich, trotz der wohl geformten, pointierten, treffsicheren Schilderung, nicht gepackt. Anders bei Meier. Er ist auf keine Pointen aus, versucht auch nicht, an seinem persönlichen Beispiel die Gesellschaft zu analysieren, dazu ist er sich zuwenig, ringt nicht um Mitleid, und statt sich mit prächtigem Stil hervortun zu wollen, versteckt er sich hinter den Sätzen, die keine literarischen Ambitionen aufweisen. Und doch: Gerade weil er so peinlich konkret ist und bei sich bleibt, bekommen seine Beschreibungen einen allgemeingültigen Charakter, gerade weil seine Sprache unliterarisch ist, fühlt sich der Leser unmittelbar angesprochen und geht mit. Da ist dann Platz für Mitleid und Mitleid am Platz. W eil Meier seine Gefühle nicht literarisch veräusserlicht, behalten sie ihre Intensität und gehen durch die «Verwertung» nicht verloren, auch wenn sie im Buch eigentlich unausgesprochen bleiben. Und das scheint mir das Wichtigste und das Wertvollste an «Stationen», und ich hab's mir für den Schluss aufgespart: Die überaus objektive, kritische Beschreibung eines Menschenlebens muss nicht kalt oder sogar, wie bei Zorn, verzweifelt böse sein, sie kann, das zeigt Meier deutlich, auch von einer Liebe, einer Herzenswärme getragen werden, die weder ihre Objektivität noch ihre Kritik herabsetzt, sondern sie im Gegenteil erst gerechtfertigt und sie als solche glaubwürdig macht. |
|
|||||||||
| © Copyright 2005 by Daniel Corti | Design by unterwww.ch |
|||||||||||